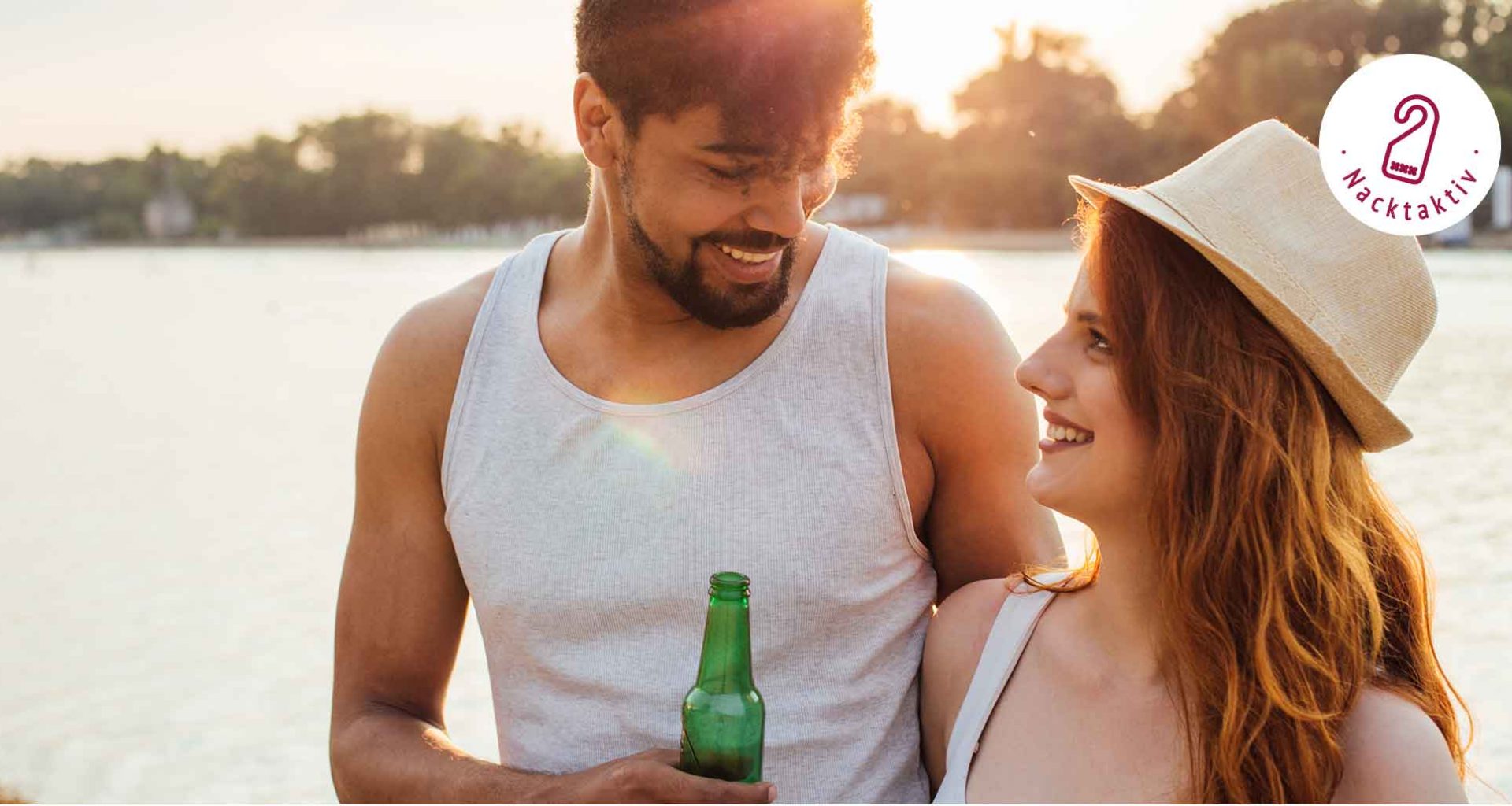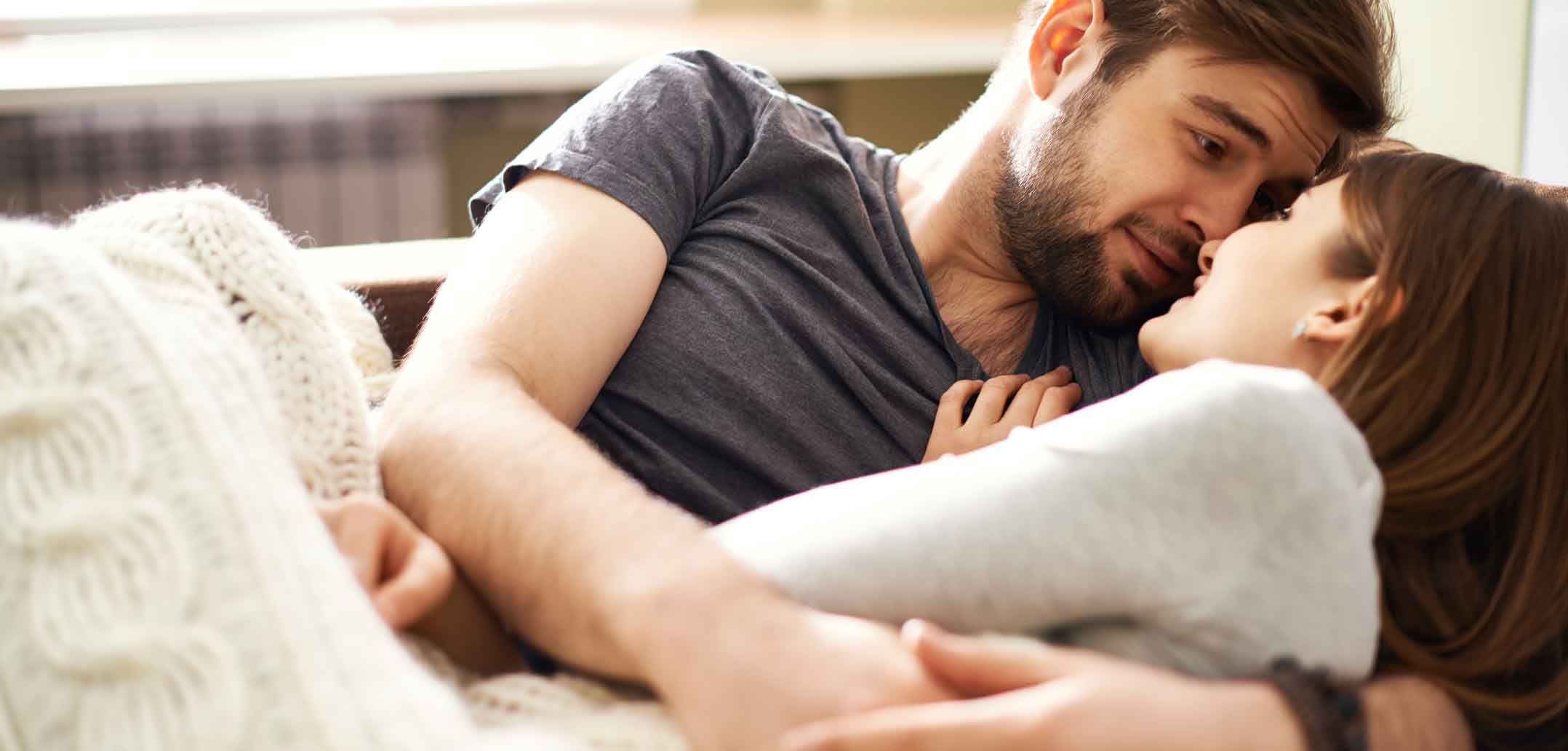Es war einer dieser warmen Sommerabende, auf die man sich ab Mitte Januar schon freut und so nahmen sie sich ein Spätibier in die Hand und gingen einfach drauf los. Und während sie so liefen und liefen, fingen sie an zu reden. Erst den ganzen Kram, den man sich so erzählt, wenn man sich achtzehn Jahre lang nicht mehr gesehen hat. Wohnorte, Studiengänge, Abbrüche, Aufbrüche. Dinge, die irgendwie plätschern. Die wichtig sind, aber eben nicht zu wichtig.
Die Gespräche wurden immer tiefer und offener
Und irgendwann, als sie sich am Maybachufer ans Wasser setzten und der Sonne beim Untergehen zuschauten und schon längst damit aufgehört hatten zu leise oder zu laut zu sein, sprachen sie miteinander. Nicht mehr über Abbrüche und Aufbrüche, sondern über Ausbrüche und Zusammenbrüche. Einfach so. Als gehöre es so. Vielleicht, weil sie sich noch aus einem alten Leben kannten. Oder, weil sie irgendwie doch Fremde füreinander waren und das manchmal leichter ist. Egal was es war, es fühlte sich richtig an.
Finn erzählte von seinem psychisch kranken Vater der, seit Finn denken konnte an schlimmen Depressionen litt und sich das Leben nahm, kurz nachdem Finn vor ein paar Jahren nach Berlin gezogen war. „Ein Teil von mir war erleichtert“, hatte Finn in sein Bier geflüstert. „Als er aufgehört hat zu kämpfen, hat er nur noch still gelitten. Und das ging über Jahre. Er war einfach nicht mehr mein Vater. Auch, wenn ich mir das immer so sehr gewünscht habe. Schon als kleines Kind habe ich alles getan, um ihn irgendwie aufzuheitern. Ihm Theaterstücke vorgespielt, Lieder gesungen. Und manchmal da hat´s geklappt. Dann hat er gelacht und mich in den Arm genommen. Aber irgendwann ging das auch nicht mehr so gut. Das mit dem Aufheitern. Und ich bin mit der Zeit immer stiller geworden.“
Sie hörten sich aufrichtig zu
„Finn, das tut mir leid. Das muss schlimm für dich gewesen sein,“ versuchte Lea tröstende Worte zu finden. In dem Wissen, dass echtes Zuhören immer mehr zählte als aufrichtige Floskeln.
„Aber weißt du, was nie aufhörte?“, Finn hatte ein paar Tränen in den Augen. „Trotz allem kam er jeden Abend an mein Bett, um mir Gute Nacht sagen. Und dann hat er mir über den Kopf gestrichen und leise gesagt „Mein kleiner Junge. Schlaf gut, mein kleiner Junge.“ Lea legte leise ihren Kopf an seine Schulter und beide schwiegen. Finn hatte noch nie zuvor so über seinen Vater gesprochen.
Lea verstand ihn. Sie kannte den Verlust von Familie und dem eigenen zu Hause. Und wie es war mit jemandem zu leben, der einem nicht nur guttut. Manchmal konnte so ein jemand weniger dafür. Er war krank und verlor gegen diese Krankheit, wie Finns Vater es vielleicht tat. Und manchmal geht es mehr um unterschiedliche Einstellungen zum Leben. Um Toleranz. Darum, in einer Familie ganz man selbst sein zu dürfen. Egal, wie man fühlt und wer man ist.